Antike französische
Großuhren
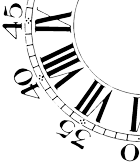

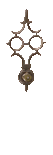
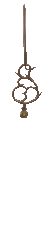
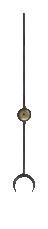
Das Portal zur Zeit - Seite 4
- Sammler-Journal, Januar 1999 -
Die Uhrenfertigung
Wie entstanden diese dekorativen, noch heute geschätzten Zeitmesser, les pendules portique? Eine Pendule wurde nicht von einem einzelnen Uhrmacher, sondern von verschiedenen Handwerkern hergestellt. Die Uhrenfertigung geschah arbeitsteilig und der Uhrmacher, der horloger-pendulier, der schließlich die Uhr signierte, war meist "geschäftsführender Organisator" und nicht Uhrmacher im herkömmlichen Sinne. Eine französische Encyclopédie von 1765 benennt 15 Spezialisten, die an Teilarbeiten beteiligt waren. Sie gehörten jedoch meist keiner Zunft an. Der fondeur pour les rous goß Räder und Platinen, der faiseur de mouvement en blanc fräste Räder und Triebe, der faiseur des ressorts fertigte Uhrfedern, die fendeuse schnitt die Räder, der graveur gravierte Messingzifferblätter, der poliseur polierte Messingteile, ein anderer versilberte sie. Bronzegehäuse fertigte ein weiterer; der doreur vergoldete Bronzeteile, der metteur en couleur bemalte sie. Der finisseur schließlich war der eigentliche Uhrmacher, setzte die Uhr zusammen, baute die Hemmung ein, polierte Zapfen usw. Andererseits kauften Pariser Uhrmacher im 18. Jahrhundert auch komplette Rohwerke und setzten sie in Gehäuse ein. "Am Beispiel von Pendeluhren mit feuervergoldeten Bronzegehäusen wird auch deutlich", schreibt Jakob Messerli (Französische Pendeluhren des 18. Jahrhunderts), "daß bei diesem Uhrentyp das Gehäuse nicht nur in ästhetischer, sondern auch in ökonomischer Hinsicht im Vordergrund stand. Teilt man nämlich die Produktionskosten auf die verschiedenen an der Herstellung beteiligten Handwerker, ergibt sich folgendes Bild: Vom Gesamtpreis entfielen in der Regel auf den Modellentwurf etwa 10 Prozent, auf den Guß 20 Prozent, auf die Ziselierung 30 Prozent, auf die Vergoldung 30 Prozent und auf das Uhrwerk lediglich 5 bis 10 Prozent." Im allgemeinen erfreut sich der Sammler alter Uhren an der Kunstfertigkeit der Meister, eine bewunderswerte Ganggenauigkeit zu erreichen. Doch in dieser Zeit gab es eine Reihe von Pendulen, bei denen das Uhrwerk die geringste Rolle spielte. Vor allem die Bronzen mit ihren allegorischen Darstellungen überzeugten und für einen Käufer konnte damals der Bronzier der ausschlaggebende Kunsthandwerker sein, nicht der Uhrmacher.

Säulenpendule, Louis seize. Frankreich, um 1790. Weißer Marmor, vergoldete Bronzeappliken, vier einliegende Porzellanplaketten. Zifferblatt signiert „Caron A Paria“ (vgl. Tardy, Dict. S. 111), fadenaufgehängtes Sonnenpendel. H 47 cm, B 38 cm, T 10 cm.

Säulenpendule, Louis seize. Frankreich, um 1770. Weißer Marmor, vergoldete Bronzen. Vier kleine Säulen zwischen zwei halbkreisförmigen Sockeln, pariser Pendulenwerk. Signiert „Masson à Paris“ (vgl. Tardy, S. 446). H 50 cm, B 28 cm, T 15 cm.